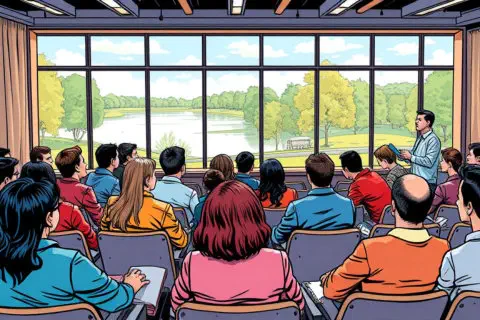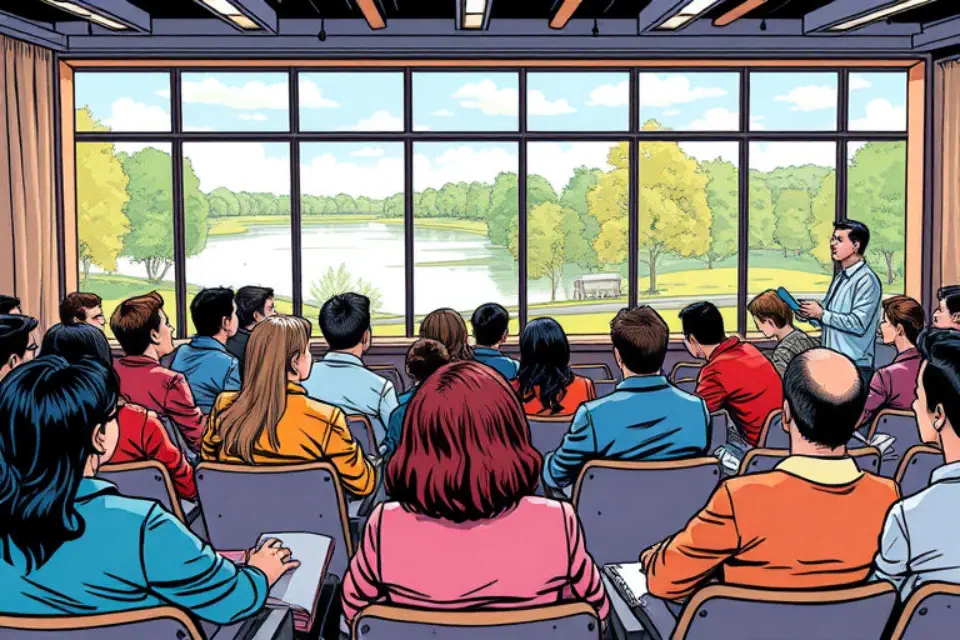Termine: Tel. +49 160 9623 2547 - E-Mail:

Inhalt des 2. Teils:
(Erster Teil: Klicken Sie hier, um zum Teil 1 zu kommen) • Wie wirken Erholung und Schlaf auf das Erinnerungsvermögen von HSP? • Mit welchen Faktoren gestalten sich Hochsensible ein besseres Leben? Eine Bestandserhebung für mehr Wohlbefinden • Einfluss von Einsamkeit auf die Verknüpfung zwischen Umweltsensitivität und Gesundheit • Schmerz und Lebensqualität: Hochsensibilität und zentrale Sensitivierung (HACS) bei chronischen Schmerzpatienten • Die Rolle der Umweltsensitivität in posttraumatischem Wachstum und im Umgang mit Stress • Schlussrunde: Hochsensibilität und psychische Gesundheit : Fragen und Antworten zu positiven und negativen Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit, Vorbeugung bei SPS, Besonderheiten bei der Psychotherapie, Verbindung zu anderen Formen der Neurodiversität, zu kultureller Akzeptanz, Unterschieden zwischen Ländern, usw.Wie wirken Erholung und Schlaf auf das
Erinnerungsvermögen von HSP?
Dr. Robert Marhenke von der Universität Innsbruck untersucht den Einfluss von Erholung im Wach- und Schlafzustand auf das Gedächtnis. Im Experiment wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide sollten zunächst zwei Listen von Wörtern auswendig lernen. • Eine Gruppe durfte daraufhin 8 Minuten lang mit geschlossenen Augen ruhen. • Die andere Gruppe sollte in der gleichen Zeit Aufgaben erfüllten, die eine visuelle Aufmerksamkeit erforderten. Eine Woche später wurden sie gefragt, an welche der Wörter sie sich erinnern konnten. • Unter Normalsensiblen gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen. • Unter den Hochsensiblen konnte sich die Gruppe mit 8 Minuten Augenpause an deutlich mehr Wörter erinnern, als der Durchschnitt, die andere Gruppe hingegen sogar an deutlich weniger als der Durchschnitt. • Dieser Unterschied bei den Hochsensiblen erschien aber nicht gleich nach dem Experiment, sondern erst bei einer Befragung nach mehreren Tagen! Interessant war auch, dass die Hochsensiblen während der Ruhepause intensivere Verbindungen in den Hirnströmen innerhalb des Ruhezustandsnetzwerks („Default Mode Network“) zwischen Hippocampus und Praecuneus aufwiesen. Das könnte auf einen Mechanismus der „Systemkonsolidierung“ hinweisen, bei dem Erinnerungen, die zunächst typischerweise im Hippocampus liegen, für eine Langzeitspeicherung in den Neocortex verlagert werden. Solche Mechanismen können im ruhigen Wachzustand auftreten, sind aber vor allem für die paradoxe Schlafphase (REM-Schlaf) typisch. Sie können ein erhöhtes Langzeitgedächtnis bedeuten – oder aber eine tiefere Erfahrungsverarbeitung. Ein weiteres Experiment mit Instagram-Nutzern verglich wieder die Wirkung von 8 Minuten Augenpause mit 8 Minuten Instagram-Surfen. Hier zeigten die hochsensiblen Instagram-Nutzer die schlechteste Erinnerungsleistung von allen, wenn sie nach 16 bzw. 35 Minuten nach den Wörtern gefragt wurden. Weitere Studien scheinen zu zeigen, dass dieses höhere Erinnerungsvermögen bei Hochsensiblen nur wirkt, wenn die Ruhepause unmittelbar nach dem Lernen erfolgt. Bei später eingelegten Pausen oder durch nächtlichen Schlaf sind hingegen keine Unterschiede festzustellen. Im Ergebnis zeigt sich, dass Hochsensible ein besseres Erinnerungsvermögen haben, wenn sie sofort nach einer neuen Erfahrung eine Ruhepause zur Verarbeitung einlegen. Wenn sie damit warten, geht dieser Vorteil verloren.Mit welchen Faktoren gestalten sich Hochsensible ein
besseres Leben? Eine Bestandserhebung für mehr
Wohlbefinden
Dr. Becky Black von der Universität Melbourne und Dr. Rohan Borschmann von der Universität Oxford führen eine laufende Untersuchung der Fachliteratur von 1990 bis heute durch. Sie suchen nach allen möglichen Faktoren, die das Wohlbefinden von Menschen mit SPS verbessern. Diese Faktoren und Strategien wirken sich wahrscheinlich positiv auf alle Menschen aus. Aber diese Wirkung scheint bei Hochsensiblen überdurchschnittlich stark zu sein. • Umfeldfaktoren: Aufmerksame und unterstützende Eltern, positive Übergänge in der Schullaufbahn, unterstützendes Arbeitsumfeld. • Verbindung zur Natur: Ein Eintauchen in die Natur verringert insbesondere das Grübeln und erhöht die Stimmung. Auch kurze Aufenthalte in der Natur wirken sich positiv aus. Wälder wirken deutlicher positiv, als Felder. • Psychologische Strategien: Achtsamkeit, Meditation, Selbstakzeptanz, positives Denken, emotionale Selbstregulierung – insbesondere Situationen bewusst mit sich selbst besprechen, um sie aus einer anderen Perspektive zu sehen und sie rationaler zu bewerten und relativieren („cognitive reappraisal“). • Gesellschaftliche Stützen und Beziehungen: Ein Austausch über die eigenen Erfahrungen mit anderen HSP bringt Validierung; das Entwickeln von zwischenmenschlichen Kompetenzen ist insbesondere wichtig zur Depressionsprävention bei jungen Menschen; ein gutes Gleichgewicht zwischen Geselligkeit und Zeiten des Alleinseins; wahrgenommene Unterstützung aus Umfeld und Familie. • Körperliche Tätigkeiten: Yoga und Meditation, regelmäßige Bewegung und Sport, gesunde Ernährung, Routinen und Strukturen. • Bewältigungsstrategien: Stilles Umfeld, geräuschunterdrückende Geräte, Emotionen ausdrücken, nach Unterstützung und Hilfe suchen, Problemlösung und Planung, Vermeidung von Überreizungen. • Persönlichkeitsentwicklung: Selbstkenntnis, insbesondere Wissen über Hochsensibilität, Bildung der emotionalen Intelligenz, Sinn und Lebenszweck finden. • Professionelle Hilfe: qualitative Psychotherapie mit Therapeuten, die mit dem Thema Hochsensibilität vertraut sind, maßgeschneiderte Interventionen (z.B. sprechen hochsensible Kinder besser auf Einzel- als auf Gruppentherapie an), Programme zur Förderung von Resilienz. • Arbeit und Karriere: Eine Karriere finden, die zur Hochsensibilität passt, in einem Umfeld, das Autonomie erlaubt und unterstützende Führungsstile übt. Im Ergebnis sieht man, wie wichtig einerseits das Umfeld, andererseits auch die persönlichen Strategien sind. Künftige Forschungen könnten die Wirkung einzelner psychologischer oder therapeutischer Interventionen untersuchen.Einfluss von Einsamkeit auf die Verknüpfung zwischen
Hochsensibilität und Gesundheit
Dr. Grant Benham von der Universität Texas im Rio-Grande-Tal untersucht, wie sich Herausforderungen im zwischenmenschlichen und geselligen Bereich auf die Gesundheit von Hochsensiblen auswirkt. Beispiele solcher Herausforderungen sind: • Defizite in den zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten, • Sozialphobie, • oberflächliche Beziehungen, • Abwesenheit von positiven Beziehungen. Nicht damit gemeint sind Introversion oder Schüchternheit. Dabei muss man bedenken, dass eine geringe Geselligkeit auch eine gewählte Bewältigungsstrategie gegen Überreizung sein kann! Über den Zusammenhang zwischen SPS und Gesundheit hat Dr. Benham schon 2006 seine erste Studie veröffentlicht – damals ging es um körperliche Symptome. Seitdem gab es verschiedene Studien über den Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und körperlichen bzw. psychischen Gesundheitsproblemen. Es ist bei Hochsensiblen ein stärkerer Hang zu Zeiträumen des freiwilligen Alleinseins bekannt. Alleinsein („solitude“) ist dabei von Einsamkeit, also unfreiwilligem und als belastend empfundenem Alleinsein („loneliness“) zu unterscheiden. Eine von Dr. Benham untersuchte Frage war diese: Sind Hochsensible auch öfter einsam? Oder reduziert das gewählte Alleinsein sogar das Gefühl der Einsamkeit? Das Ergebnis zeigte, dass HSP tatsächlich öfter Gefühle der Einsamkeit haben, als Normalsensible, und dies durch den Hang zum bewussten Alleinsein nicht positiv beeinflusst ist. Die Studie befragte allerdings vor allem junge Erwachsene mit lateinamerikanischem Hintergrund im Süden von Texas, basierte auf Selbstauskunft und fragte nicht nach eventuellen Schwierigkeiten in der Kindheit. Weitere Forschungsergebnisse zeigen eine Paradoxie des Alleinseins: Der Hang zum Alleinsein bewirkt keine Besserung im Wohlbefinden, wenn Menschen nicht psychisch gesund sind. Anders gesagt: Wenn überhaupt, wird Alleinsein nur von Gesunden als entlastend empfunden.Schmerz und Lebensqualität: Hochsensibilität und zentrale
Sensitivierung bei chronischen Schmerzpatienten
Dr. Veronique de Gucht von der Universität in Leiden (Niederlande) studiert derzeit die Zusammenhänge zwischen zentraler Sensitivierung (HACS - „Human Assumed Central Sensitisation“) und Lebensqualität bei Hochsensiblen. Worum geht es bei zentraler Sensitivierung? Manche chronischen Schmerzpatienten entwickeln auf Dauer ein solch empfindliches Schmerzsystem, dass selbst nicht- schmerzhafte Reize zu übermäßigem Schmerz führen. Es kann auch geschehen, dass allein die Möglichkeit von künftigem Schmerz zu übermäßigen Schmerzerwartungen („pain catastrophising“), Grübeleien und Gefühlen der Hilflosigkeit führen. Die Schwierigkeit in der Forschung besteht darin, dass das Schmerzempfinden subjektiv wahrgenommen wird und nicht objektiv messbar ist. Dafür wurden verschiedene spezialisierte Fragebögen entwickelt: • Central Sensitization Inventory (CSI), • Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF), • für die Lebensqualität die Short Form Health Survey-12 (SF-12v2), • und für die Hochsensibilität hat Dr. de Gucht selbst einen Fragebogen entwickelt, den Sensory Processing Sensitivity Questionnaire (SPSQ – www.sps-q.com). Objektive Schmerzmessungen bleiben schwierig. Aber man versucht, etwas Objektivität hineinzubringen, z.B. mit dem Kaltwassertest. (Dabei werden Gliedmaßen in kaltes Wasser getaucht und die physiologischen Auswirkungen auf Herz und Kreislauf gemessen.) Eine Schlüsselfrage in der aktuellen Studie war: Wie erleben und bewerten die Menschen grundsätzlich ihre Hochsensibilität – als positiv oder als negativ? • Bei Menschen, die ihre Hochsensibilität eher negativ erleben, schlugen die zentrale Sensitivierung und insbesondere die Schmerzerwartung stärker durch, als bei Normalsensiblen. • Eine positive Hochsensibilität hingegen konnte die Schmerzerwartungen gegenüber Normalsensiblen sogar verringern! Das führte zu einer geringeren zentralen Sensitivierung. Es zeigt sich, dass hier eine Verkettung, die von der Schmerzerwartung zur Lebensqualität führt, eine zentrale Rolle spielt: 1. Eine positiv erlebte und bejahte Hochsensibilität führt zu geringerer Schmerzerwartung. 2. Eine geringere Schmerzerwartung verringert wiederum die zentrale Sensitivierung. 3. Diese geringere Sensitivierung führt zu mehr Lebensqualität. Dadurch ergeben sich Ansätze für Interventionen. Insbesondere sollten Therapien beide Bereiche behandeln: • den kognitiven Bereich (Schmerzerwartung) • und den physiologischen Bereich (Sensitivierung). Es fällt noch schwer, allgemeingültige Empfehlungen für Schmerzpatienten zu geben, um ihre Schmerzerwartungen zu senken und damit die Lebensqualität zu beeinflussen. In den Schmerzkliniken werden aber zunehmend Achtsamkeitstechniken eingesetzt. Künftige Forschungsrichtungen können weitere Faktoren wie z.B. Art und Dauer des Schmerzes und Behandlungsformen unter die Lupe nehmen.Die Rolle der Umweltsensitivität in posttraumatischem
Wachstum und im Umgang mit Stress
Maria Jernslett ist Doktorandin an der Universität Edinburgh und interessiert sich für die folgenden Fragen: Wie kann man an Traumata wachsen? Und welche Rolle spielt dabei die Hochsensibilität? Posttraumatisches Wachstum bedeutet, das Trauma zu verarbeiten, zu integrieren und dadurch daran zu wachsen. Posttraumatische Belastungsstörungen und posttraumatisches Wachstum schließen einander keineswegs aus. Eine Meta-Analyse zeigte: Beides kann durchaus parallel stattfinden! Am häufigsten tritt beides zusammen auf, wenn das Trauma moderat ist. Faktoren, die ein Wachsen am Trauma fördern, sind insbesondere: • zwischenmenschliche Intimität und Verbindung, • spirituelles Wachstum, • und ein Sinn für die eigenen Stärken - den man entwickeln sollte, wenn er noch nicht vorhanden ist. Frau Jernsletts Studie umfasst die Befragung von 302 Erwachsenen, von denen die meisten über ein überdurchschnittliches Trauma berichteten. Die meisten waren gut ausgebildete Frauen, was nach Aussage der Autorin die Allgemeingültigkeit der Studie einschränkt. Eine weitere Einschränkung sind die kognitiven Verzerrungen, die entstehen, wenn man eine Situation im Nachhinein bewertet und bereits ein Narrativ daraus entwickelt hat, also eine schlüssige Geschichte. Die Ergebnisse: • Das posttraumatische Wachstum zeigte sich am stärksten bei Menschen mit mittlerer Sensibilität. • Bei geringer Sensibilität fehlt es offenbar an emotionalen Bewältigungsmechanismen. • Hochsensible Menschen tendieren zu emotionaler Überforderung, sodass das posttraumatische Wachstum gehemmt sein kann, insbesondere bei starkem Trauma. • Ein Teilaspekt stach heraus: Eine ästhetische Sensibilität scheint mit höherem posttraumatischem Wachstum einher zu gehen. Diese Verbindung funktioniert aber nur, wenn das Umfeld unterstützend ist, oder auch wenn man eine Therapie in Anspruch nimmt. Das Umfeld erweist sich also als ein Schlüssel, denn es kann sich positiv und negativ auswirken - und tut in der Regel beides. Kann man daraus schließen, dass HSP mehr Resilienz besitzen? Dazu ist der Begriff der Resilienz zu komplex und allgemein. Schränkt man aber den Blick auf das persönliche Wachstum ein, zeigt sich auch hier, dass dies bei HSP überdurchschnittlich gut erfolgen kann – aber nur wenn das Umfeld günstig ist.Schlussrunde: Hochsensibilität und psychische
Gesundheit
Die Veranstaltung endete mit einem von Michael Pluess moderierten Podiumsgespräch zusammen mit Francesca Lionetti, Corina Greven, Tom Falkenstein, Elizabeth Roxburgh und Elena Lupo. Haben Hochsensible häufiger psychische Gesundheitsprobleme? Die Studienlage suggeriert einen moderaten Zusammenhang zwischen beidem. Allerdings isolieren sie laut Prof. Greven zu selten Umweltsensitivität vom sog, Neurotizismus (Neigung zu negativen Emotionen und Gefühlen), einem der fünf Bestandteile des „Big Five“-Persönlichkeitsmodells. Und die allermeisten Studien beruhen auf Selbstauskunft der Probanden. Objektive Messungen sind in diesem Bereich noch schwierig. Auch die Anzahl der Probanden bleibt häufig gering. Zumindest bei Burnout und Depression scheint es einen moderaten Zusammenhang mit Hochsensibilität zu geben. Welche biologischen, neurologischen und medizinischen Faktoren könnten eine Rolle dabei spielen, dass Hochsensibilität mit erhöhten psychischen Problemen in Verbindung steht? Dafür gibt es laut Dr. Elizabeth Roxburgh von der Universität von Canterbury noch kein brauchbares Erklärungsmodell. Ein Bestandteil kann sein, dass sich viele HSP in ihrer Kindheit und Jugend nicht akzeptiert fühlen und es schon dann, oder erst später, die psychische Anfälligkeit erhöht. Gesellschaftliche Erwartungen und Normen sowie diverse Diskriminierungsformen spielen auch eine Rolle. Burnout kann von hoher Arbeitslast kommen, aber es gibt auch die Erschöpfung durch Überforderung von Mitgefühl und Empathie! Man hat sich nicht ausreichend selbst geschützt und gerät in ein Empathie-Burnout. Sollten psychotherapeutische Behandlungen spezifisch an Hochsensible angepasst werden? Tom Falkenstein ist Psychotherapeut aus Deutschland mit Praxis in England. Er denkt einerseits, dass Interventionen, die auf ein bestimmtes Leiden abgestimmt sind, bei allen anwendbar sind und nicht speziell an HSP angepasst werden müssen. Andererseits hat er immer wieder Anfragen von HSP, die verschiedene Therapien besucht haben, damit unzufrieden waren und nun nach jemandem suchen, der mit dem Thema Hochsensibilität vertraut ist. Der vielleicht wichtigste Schlüsselfaktor ist immer die therapeutische Beziehung. Ein gutes Verständnis der Hochsensibilität ist für diese Beziehungsqualität sicher hilfreich. Man kann also sagen: Therapeuten sollten immer die Hochsensibilität ihrer Patienten im Hinterkopf behalten, können aber darüber hinaus die gleichen Interventionen wie bei anderen Patienten anwenden. Sind Hochsensible leichter psychotherapeutisch zu behandeln? In Herrn Falkensteins Erfahrung ist die therapeutische Beziehung mit HSP oft tiefgehender. Es könnte sein, dass das auch den Behandlungserfolg fördert. Akzeptanz der Hochsensibilität: Welche Unterschiede gibt es zwischen den Ländern? Dr. Elizabeth Roxburgh weiß von Befragungen von Studenten in verschiedenen Ländern. Dabei zeigt sich: Hochsensible in China fühlen sich im Leben überdurchschnittlich wohl. Im Vereinigten Königreich hingegen ist ihr Wohlbefinden unterdurchschnittlich. Elena Lupo gab in Italien ihren Kassensitz ab und wurde Coach und Beraterin, um institutionellen Einschränkungen in den Behandlungsformen zu entkommen. Sie gründete ihren eigenen Verband und bildet heute Therapeuten aus. Sie bemerkt, wie immer noch viele Menschen Hochsensibilität als eine New-Age-Marotte einordnen, oder als Koketterie, oder als Verlegenheitserklärung für jugendlichen Suizid, oder auch als anderen Namen für leichten Autismus. Tom Falkenstein sieht in Deutschland einen Wandel in den letzten 10 Jahren. Mehr Akzeptanz für das Thema Hochsensibilität ist vorhanden. Aber es werden immer noch wenige Gelder für Forschungen bereit gestellt. Elizabeth Roxburgh stellt fest, dass es im Vereinigten Königreich derzeit keine Fortbildungsprogramme in Umweltsensitivität gibt. Das würde aber helfen. Steht Hochsensibilität in Verbindung zu ADHS oder Autismus? Diese Frage kommt sehr häufig auf. Prof. Corina Greven kommt ursprünglich aus der ADHS-Forschung und hat auch enge Verbindungen zur Autismusforschung. Die Studienlage sieht derzeit eher keine Verbindung. Manche Studien zeigen eine leichte Korrelation, die aber nicht bestätigt ist. Die Studienqualität ist meistens schwach: Es werden kleine Personenzahlen befragt, und statt klinisch gefestigter Diagnosen beruhen die Studien üblicherweise auf einer Selbstauskunft. Außerdem: Selbst wenn es eine statistische Korrelation gäbe, würde das noch nicht viel sagen, insbesondere zu tiefer liegenden Ursachen. Welche Rolle spielt Vorbeugung im Wohlbefinden von Hochsensiblen? Eine Menge Punkte wurden schon weiter oben angesprochen, insbesondere von Dr. Black. Dr. Roxburgh erkennt insbesondere Faktoren wie eine Verbindung zur Natur, ein gutes Gleichgewicht zwischen Geselligkeit und Alleinsein, und Persönlichkeitsentwicklung (etwa ein Dankbarkeitstagebuch, denn das scheint tatsächlich zu wirken). Wichtig sind auch Beziehungen mit echter Nähe. Hochsensible tendieren eher zu emotionaler als zu sozialer Einsamkeit. Sind die Beziehungen zu oberflächlich, kann es sein, dass sich HSP mit Menschen einsamer fühlen als ohne. Atemtechniken, kreative Aufgaben, und Selbstakzeptanz helfen ebenfalls. Außerdem können alle dafür wirken, dass das gesellschaftliche Bewusstsein für Hochsensibilität steigt, und versuchen, sich mit anderen HSP in ihrer Region zu verbinden. Kann sich Hochsensibilität auch positiv auf die psychische Gesundheit auswirken? Tom Falkenstein hilft seinen hochsensiblen Patienten immer, Situationen aus anderer Perspektive umzudeuten („Reframing“), und nutzt Psychoedukation, damit sich Hochsensible besser selbst verstehen und damit sie der Ressourcen bewusst werden, die sich aus ihrer Hochsensibilität ergeben. Elena Lupo sieht bei der psychischen Gesundheit einen sehr großen Unterschied zwischen Hochsensiblen, die Hilfe aufsuchen, und denen, die das nicht tun. Dabei sind Unterstützungen und Anleitungen im Umgang mit der Hochsensibilität und der Steigerung der Selbstwirksamkeit sehr hilfreich. Außerdem ist es für HSP wichtig, sich mit höheren Aufgaben oder Zielen zu verbinden – mit einem größeren Ganzen, ggf. auf einer spirituellen Ebene. Ebenfalls wichtig ist es für Hochsensible, aus dem Kopf heraus zu kommen. In der Regel denken sie zu viel. Denken und Fühlen müssen besser miteinander integriert werden. Körperbezogene Interventionen sind dabei hilfreich. Somatic Experiencing ist ein Beispiel dafür. Gibt es eine Verbindung zwischen Hochsensibilität und Introversion / Extraversion? Intro- und Extraversion scheinen bei HSP nicht anders als in der allgemeinen Bevölkerung verteilt zu sein. Betrachtet man die fünf Teile des „Big Five“-Persönlichkeitsmodells (zu denen auch Extraversion / Introversion gehört), korreliert Hochsensibilität eher mit den Bestandteilen Neurotizismus und Offenheit für Neues. Informationen zu neuen wissenschaftlichen Studien und über die kommenden Forschungsveranstaltungen findet sich im Netzwerk Sensitivity Research. Lesen Sie auch: • Gipfeltreffen der Hochsensibilitätsforschung 2024: ein Bericht • Coaching für hochsensible Menschen • Hochsensibilität am Arbeitsplatz und im Management • Schattenseiten der Hochsensibilität • Weitere Artikel und Blogs • Ablauf einer ersten Coachingsitzung • Kontakt und TerminvereinbarungAlexander Hohmann - Blog des Coachs
Coaching und mehr
Inhalt des 2. Teils:
(Erster Teil: Klicken Sie hier, um zum Teil 1 zu kommen) • Wie wirken Erholung und Schlaf auf das Erinnerungsvermögen von HSP? • Mit welchen Faktoren gestalten sich Hochsensible ein besseres Leben? Eine Bestandserhebung für mehr Wohlbefinden • Einfluss von Einsamkeit auf die Verknüpfung zwischen Umweltsensitivität und Gesundheit • Schmerz und Lebensqualität: Hochsensibilität und zentrale Sensitivierung (HACS) bei chronischen Schmerzpatienten • Die Rolle der Umweltsensitivität in posttraumatischem Wachstum und im Umgang mit Stress • Schlussrunde: Hochsensibilität und psychische Gesundheit : Fragen und Antworten zu positiven und negativen Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit, Vorbeugung bei SPS, Besonderheiten bei der Psychotherapie, Verbindung zu anderen Formen der Neurodiversität, zu kultureller Akzeptanz, Unterschieden zwischen Ländern, usw.Wie wirken Erholung und Schlaf
auf das Erinnerungsvermögen
von HSP?
Dr. Robert Marhenke von der Universität Innsbruck untersucht den Einfluss von Erholung im Wach- und Schlafzustand auf das Gedächtnis. Im Experiment wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide sollten zunächst zwei Listen von Wörtern auswendig lernen. • Eine Gruppe durfte daraufhin 8 Minuten lang mit geschlossenen Augen ruhen. • Die andere Gruppe sollte in der gleichen Zeit Aufgaben erfüllten, die eine visuelle Aufmerksamkeit erforderten. Eine Woche später wurden sie gefragt, an welche der Wörter sie sich erinnern konnten. • Unter Normalsensiblen gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen. • Unter den Hochsensiblen konnte sich die Gruppe mit 8 Minuten Augenpause an deutlich mehr Wörter erinnern, als der Durchschnitt, die andere Gruppe hingegen sogar an deutlich weniger als der Durchschnitt. • Dieser Unterschied bei den Hochsensiblen erschien aber nicht gleich nach dem Experiment, sondern erst bei einer Befragung nach mehreren Tagen! Interessant war auch, dass die Hochsensiblen während der Ruhepause intensivere Verbindungen in den Hirnströmen innerhalb des Ruhezustandsnetzwerks („Default Mode Network“) zwischen Hippocampus und Praecuneus aufwiesen. Das könnte auf einen Mechanismus der „Systemkonsolidierung“ hinweisen, bei dem Erinnerungen, die zunächst typischerweise im Hippocampus liegen, für eine Langzeitspeicherung in den Neocortex verlagert werden. Solche Mechanismen können im ruhigen Wachzustand auftreten, sind aber vor allem für die paradoxe Schlafphase (REM-Schlaf) typisch. Sie können ein erhöhtes Langzeitgedächtnis bedeuten – oder aber eine tiefere Erfahrungsverarbeitung. Ein weiteres Experiment mit Instagram-Nutzern verglich wieder die Wirkung von 8 Minuten Augenpause mit 8 Minuten Instagram-Surfen. Hier zeigten die hochsensiblen Instagram-Nutzer die schlechteste Erinnerungsleistung von allen, wenn sie nach 16 bzw. 35 Minuten nach den Wörtern gefragt wurden. Weitere Studien scheinen zu zeigen, dass dieses höhere Erinnerungsvermögen bei Hochsensiblen nur wirkt, wenn die Ruhepause unmittelbar nach dem Lernen erfolgt. Bei später eingelegten Pausen oder durch nächtlichen Schlaf sind hingegen keine Unterschiede festzustellen. Im Ergebnis zeigt sich, dass Hochsensible ein besseres Erinnerungsvermögen haben, wenn sie sofort nach einer neuen Erfahrung eine Ruhepause zur Verarbeitung einlegen. Wenn sie damit warten, geht dieser Vorteil verloren.Mit welchen Faktoren gestalten
sich Hochsensible ein besseres
Leben? Eine Bestandserhebung
für mehr Wohlbefinden
Dr. Becky Black von der Universität Melbourne und Dr. Rohan Borschmann von der Universität Oxford führen eine laufende Untersuchung der Fachliteratur von 1990 bis heute durch. Sie suchen nach allen möglichen Faktoren, die das Wohlbefinden von Menschen mit SPS verbessern. Diese Faktoren und Strategien wirken sich wahrscheinlich positiv auf alle Menschen aus. Aber diese Wirkung scheint bei Hochsensiblen überdurchschnittlich stark zu sein. • Umfeldfaktoren: Aufmerksame und unterstützende Eltern, positive Übergänge in der Schullaufbahn, unterstützendes Arbeitsumfeld. • Verbindung zur Natur: Ein Eintauchen in die Natur verringert insbesondere das Grübeln und erhöht die Stimmung. Auch kurze Aufenthalte in der Natur wirken sich positiv aus. Wälder wirken deutlicher positiv, als Felder. • Psychologische Strategien: Achtsamkeit, Meditation, Selbstakzeptanz, positives Denken, emotionale Selbstregulierung – insbesondere Situationen bewusst mit sich selbst besprechen, um sie aus einer anderen Perspektive zu sehen und sie rationaler zu bewerten und relativieren („cognitive reappraisal“). • Gesellschaftliche Stützen und Beziehungen: Ein Austausch über die eigenen Erfahrungen mit anderen HSP bringt Validierung; das Entwickeln von zwischenmenschlichen Kompetenzen ist insbesondere wichtig zur Depressionsprävention bei jungen Menschen; ein gutes Gleichgewicht zwischen Geselligkeit und Zeiten des Alleinseins; wahrgenommene Unterstützung aus Umfeld und Familie. • Körperliche Tätigkeiten: Yoga und Meditation, regelmäßige Bewegung und Sport, gesunde Ernährung, Routinen und Strukturen. • Bewältigungsstrategien: Stilles Umfeld, geräuschunterdrückende Geräte, Emotionen ausdrücken, nach Unterstützung und Hilfe suchen, Problemlösung und Planung, Vermeidung von Überreizungen. • Persönlichkeitsentwicklung: Selbstkenntnis, insbesondere Wissen über Hochsensibilität, Bildung der emotionalen Intelligenz, Sinn und Lebenszweck finden. • Professionelle Hilfe: qualitative Psychotherapie mit Therapeuten, die mit dem Thema Hochsensibilität vertraut sind, maßgeschneiderte Interventionen (z.B. sprechen hochsensible Kinder besser auf Einzel- als auf Gruppentherapie an), Programme zur Förderung von Resilienz. • Arbeit und Karriere: Eine Karriere finden, die zur Hochsensibilität passt, in einem Umfeld, das Autonomie erlaubt und unterstützende Führungsstile übt. Im Ergebnis sieht man, wie wichtig einerseits das Umfeld, andererseits auch die persönlichen Strategien sind. Künftige Forschungen könnten die Wirkung einzelner psychologischer oder therapeutischer Interventionen untersuchen.Einfluss von Einsamkeit auf die
Verknüpfung zwischen
Hochsensibilität und
Gesundheit
Dr. Grant Benham von der Universität Texas im Rio-Grande-Tal untersucht, wie sich Herausforderungen im zwischenmenschlichen und geselligen Bereich auf die Gesundheit von Hochsensiblen auswirkt. Beispiele solcher Herausforderungen sind: • Defizite in den zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten, • Sozialphobie, • oberflächliche Beziehungen, • Abwesenheit von positiven Beziehungen. Nicht damit gemeint sind Introversion oder Schüchternheit. Dabei muss man bedenken, dass eine geringe Geselligkeit auch eine gewählte Bewältigungsstrategie gegen Überreizung sein kann! Über den Zusammenhang zwischen SPS und Gesundheit hat Dr. Benham schon 2006 seine erste Studie veröffentlicht – damals ging es um körperliche Symptome. Seitdem gab es verschiedene Studien über den Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und körperlichen bzw. psychischen Gesundheitsproblemen. Es ist bei Hochsensiblen ein stärkerer Hang zu Zeiträumen des freiwilligen Alleinseins bekannt. Alleinsein („solitude“) ist dabei von Einsamkeit, also unfreiwilligem und als belastend empfundenem Alleinsein („loneliness“) zu unterscheiden. Eine von Dr. Benham untersuchte Frage war diese: Sind Hochsensible auch öfter einsam? Oder reduziert das gewählte Alleinsein sogar das Gefühl der Einsamkeit? Das Ergebnis zeigte, dass HSP tatsächlich öfter Gefühle der Einsamkeit haben, als Normalsensible, und dies durch den Hang zum bewussten Alleinsein nicht positiv beeinflusst ist. Die Studie befragte allerdings vor allem junge Erwachsene mit lateinamerikanischem Hintergrund im Süden von Texas, basierte auf Selbstauskunft und fragte nicht nach eventuellen Schwierigkeiten in der Kindheit. Weitere Forschungsergebnisse zeigen eine Paradoxie des Alleinseins: Der Hang zum Alleinsein bewirkt keine Besserung im Wohlbefinden, wenn Menschen nicht psychisch gesund sind. Anders gesagt: Wenn überhaupt, wird Alleinsein nur von Gesunden als entlastend empfunden.Schmerz und Lebensqualität:
Hochsensibilität und zentrale
Sensitivierung bei chronischen
Schmerzpatienten
Dr. Veronique de Gucht von der Universität in Leiden (Niederlande) studiert derzeit die Zusammenhänge zwischen zentraler Sensitivierung (HACS - „Human Assumed Central Sensitisation“) und Lebensqualität bei Hochsensiblen. Worum geht es bei zentraler Sensitivierung? Manche chronischen Schmerzpatienten entwickeln auf Dauer ein solch empfindliches Schmerzsystem, dass selbst nicht-schmerzhafte Reize zu übermäßigem Schmerz führen. Es kann auch geschehen, dass allein die Möglichkeit von künftigem Schmerz zu übermäßigen Schmerzerwartungen („pain catastrophising“), Grübeleien und Gefühlen der Hilflosigkeit führen. Die Schwierigkeit in der Forschung besteht darin, dass das Schmerzempfinden subjektiv wahrgenommen wird und nicht objektiv messbar ist. Dafür wurden verschiedene spezialisierte Fragebögen entwickelt: • Central Sensitization Inventory (CSI), • Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF), • für die Lebensqualität die Short Form Health Survey-12 (SF-12v2), • und für die Hochsensibilität hat Dr. de Gucht selbst einen Fragebogen entwickelt, den Sensory Processing Sensitivity Questionnaire (SPSQ – www.sps-q.com). Objektive Schmerzmessungen bleiben schwierig. Aber man versucht, etwas Objektivität hineinzubringen, z.B. mit dem Kaltwassertest. (Dabei werden Gliedmaßen in kaltes Wasser getaucht und die physiologischen Auswirkungen auf Herz und Kreislauf gemessen.) Eine Schlüsselfrage in der aktuellen Studie war: Wie erleben und bewerten die Menschen grundsätzlich ihre Hochsensibilität – als positiv oder als negativ? • Bei Menschen, die ihre Hochsensibilität eher negativ erleben, schlugen die zentrale Sensitivierung und insbesondere die Schmerzerwartung stärker durch, als bei Normalsensiblen. • Eine positive Hochsensibilität hingegen konnte die Schmerzerwartungen gegenüber Normalsensiblen sogar verringern! Das führte zu einer geringeren zentralen Sensitivierung. Es zeigt sich, dass hier eine Verkettung, die von der Schmerzerwartung zur Lebensqualität führt, eine zentrale Rolle spielt: 1. Eine positiv erlebte und bejahte Hochsensibilität führt zu geringerer Schmerzerwartung. 2. Eine geringere Schmerzerwartung verringert wiederum die zentrale Sensitivierung. 3. Diese geringere Sensitivierung führt zu mehr Lebensqualität. Dadurch ergeben sich Ansätze für Interventionen. Insbesondere sollten Therapien beide Bereiche behandeln: • den kognitiven Bereich (Schmerzerwartung) • und den physiologischen Bereich (Sensitivierung). Es fällt noch schwer, allgemeingültige Empfehlungen für Schmerzpatienten zu geben, um ihre Schmerzerwartungen zu senken und damit die Lebensqualität zu beeinflussen. In den Schmerzkliniken werden aber zunehmend Achtsamkeitstechniken eingesetzt. Künftige Forschungsrichtungen können weitere Faktoren wie z.B. Art und Dauer des Schmerzes und Behandlungsformen unter die Lupe nehmen.Die Rolle der Umweltsensitivität
in posttraumatischem
Wachstum und im Umgang mit
Stress
Maria Jernslett ist Doktorandin an der Universität Edinburgh und interessiert sich für die folgenden Fragen: Wie kann man an Traumata wachsen? Und welche Rolle spielt dabei die Hochsensibilität? Posttraumatisches Wachstum bedeutet, das Trauma zu verarbeiten, zu integrieren und dadurch daran zu wachsen. Posttraumatische Belastungsstörungen und posttraumatisches Wachstum schließen einander keineswegs aus. Eine Meta-Analyse zeigte: Beides kann durchaus parallel stattfinden! Am häufigsten tritt beides zusammen auf, wenn das Trauma moderat ist. Faktoren, die ein Wachsen am Trauma fördern, sind insbesondere: • zwischenmenschliche Intimität und Verbindung, • spirituelles Wachstum, • und ein Sinn für die eigenen Stärken - den man entwickeln sollte, wenn er noch nicht vorhanden ist. Frau Jernsletts Studie umfasst die Befragung von 302 Erwachsenen, von denen die meisten über ein überdurchschnittliches Trauma berichteten. Die meisten waren gut ausgebildete Frauen, was nach Aussage der Autorin die Allgemeingültigkeit der Studie einschränkt. Eine weitere Einschränkung sind die kognitiven Verzerrungen, die entstehen, wenn man eine Situation im Nachhinein bewertet und bereits ein Narrativ daraus entwickelt hat, also eine schlüssige Geschichte. Die Ergebnisse: • Das posttraumatische Wachstum zeigte sich am stärksten bei Menschen mit mittlerer Sensibilität. • Bei geringer Sensibilität fehlt es offenbar an emotionalen Bewältigungsmechanismen. • Hochsensible Menschen tendieren zu emotionaler Überforderung, sodass das posttraumatische Wachstum gehemmt sein kann, insbesondere bei starkem Trauma. • Ein Teilaspekt stach heraus: Eine ästhetische Sensibilität scheint mit höherem posttraumatischem Wachstum einher zu gehen. Diese Verbindung funktioniert aber nur, wenn das Umfeld unterstützend ist, oder auch wenn man eine Therapie in Anspruch nimmt. Das Umfeld erweist sich also als ein Schlüssel, denn es kann sich positiv und negativ auswirken - und tut in der Regel beides. Kann man daraus schließen, dass HSP mehr Resilienz besitzen? Dazu ist der Begriff der Resilienz zu komplex und allgemein. Schränkt man aber den Blick auf das persönliche Wachstum ein, zeigt sich auch hier, dass dies bei HSP überdurchschnittlich gut erfolgen kann – aber nur wenn das Umfeld günstig ist.Schlussrunde: Hochsensibilität
und psychische Gesundheit
Die Veranstaltung endete mit einem von Michael Pluess moderierten Podiumsgespräch zusammen mit Francesca Lionetti, Corina Greven, Tom Falkenstein, Elizabeth Roxburgh und Elena Lupo. Haben Hochsensible häufiger psychische Gesundheitsprobleme? Die Studienlage suggeriert einen moderaten Zusammenhang zwischen beidem. Allerdings isolieren sie laut Prof. Greven zu selten Umweltsensitivität vom sog, Neurotizismus (Neigung zu negativen Emotionen und Gefühlen), einem der fünf Bestandteile des „Big Five“-Persönlichkeitsmodells. Und die allermeisten Studien beruhen auf Selbstauskunft der Probanden. Objektive Messungen sind in diesem Bereich noch schwierig. Auch die Anzahl der Probanden bleibt häufig gering. Zumindest bei Burnout und Depression scheint es einen moderaten Zusammenhang mit Hochsensibilität zu geben. Welche biologischen, neurologischen und medizinischen Faktoren könnten eine Rolle dabei spielen, dass Hochsensibilität mit erhöhten psychischen Problemen in Verbindung steht? Dafür gibt es laut Dr. Elizabeth Roxburgh von der Universität von Canterbury noch kein brauchbares Erklärungsmodell. Ein Bestandteil kann sein, dass sich viele HSP in ihrer Kindheit und Jugend nicht akzeptiert fühlen und es schon dann, oder erst später, die psychische Anfälligkeit erhöht. Gesellschaftliche Erwartungen und Normen sowie diverse Diskriminierungsformen spielen auch eine Rolle. Burnout kann von hoher Arbeitslast kommen, aber es gibt auch die Erschöpfung durch Überforderung von Mitgefühl und Empathie! Man hat sich nicht ausreichend selbst geschützt und gerät in ein Empathie-Burnout. Sollten psychotherapeutische Behandlungen spezifisch an Hochsensible angepasst werden? Tom Falkenstein ist Psychotherapeut aus Deutschland mit Praxis in England. Er denkt einerseits, dass Interventionen, die auf ein bestimmtes Leiden abgestimmt sind, bei allen anwendbar sind und nicht speziell an HSP angepasst werden müssen. Andererseits hat er immer wieder Anfragen von HSP, die verschiedene Therapien besucht haben, damit unzufrieden waren und nun nach jemandem suchen, der mit dem Thema Hochsensibilität vertraut ist. Der vielleicht wichtigste Schlüsselfaktor ist immer die therapeutische Beziehung. Ein gutes Verständnis der Hochsensibilität ist für diese Beziehungsqualität sicher hilfreich. Man kann also sagen: Therapeuten sollten immer die Hochsensibilität ihrer Patienten im Hinterkopf behalten, können aber darüber hinaus die gleichen Interventionen wie bei anderen Patienten anwenden. Sind Hochsensible leichter psychotherapeutisch zu behandeln? In Herrn Falkensteins Erfahrung ist die therapeutische Beziehung mit HSP oft tiefgehender. Es könnte sein, dass das auch den Behandlungserfolg fördert. Akzeptanz der Hochsensibilität: Welche Unterschiede gibt es zwischen den Ländern? Dr. Elizabeth Roxburgh weiß von Befragungen von Studenten in verschiedenen Ländern. Dabei zeigt sich: Hochsensible in China fühlen sich im Leben überdurchschnittlich wohl. Im Vereinigten Königreich hingegen ist ihr Wohlbefinden unterdurchschnittlich. Elena Lupo gab in Italien ihren Kassensitz ab und wurde Coach und Beraterin, um institutionellen Einschränkungen in den Behandlungsformen zu entkommen. Sie gründete ihren eigenen Verband und bildet heute Therapeuten aus. Sie bemerkt, wie immer noch viele Menschen Hochsensibilität als eine New- Age-Marotte einordnen, oder als Koketterie, oder als Verlegenheitserklärung für jugendlichen Suizid, oder auch als anderen Namen für leichten Autismus. Tom Falkenstein sieht in Deutschland einen Wandel in den letzten 10 Jahren. Mehr Akzeptanz für das Thema Hochsensibilität ist vorhanden. Aber es werden immer noch wenige Gelder für Forschungen bereit gestellt. Elizabeth Roxburgh stellt fest, dass es im Vereinigten Königreich derzeit keine Fortbildungsprogramme in Umweltsensitivität gibt. Das würde aber helfen. Steht Hochsensibilität in Verbindung zu ADHS oder Autismus? Diese Frage kommt sehr häufig auf. Prof. Corina Greven kommt ursprünglich aus der ADHS-Forschung und hat auch enge Verbindungen zur Autismusforschung. Die Studienlage sieht derzeit eher keine Verbindung. Manche Studien zeigen eine leichte Korrelation, die aber nicht bestätigt ist. Die Studienqualität ist meistens schwach: Es werden kleine Personenzahlen befragt, und statt klinisch gefestigter Diagnosen beruhen die Studien üblicherweise auf einer Selbstauskunft. Außerdem: Selbst wenn es eine statistische Korrelation gäbe, würde das noch nicht viel sagen, insbesondere zu tiefer liegenden Ursachen. Welche Rolle spielt Vorbeugung im Wohlbefinden von Hochsensiblen? Eine Menge Punkte wurden schon weiter oben angesprochen, insbesondere von Dr. Black. Dr. Roxburgh erkennt insbesondere Faktoren wie eine Verbindung zur Natur, ein gutes Gleichgewicht zwischen Geselligkeit und Alleinsein, und Persönlichkeitsentwicklung (etwa ein Dankbarkeitstagebuch, denn das scheint tatsächlich zu wirken). Wichtig sind auch Beziehungen mit echter Nähe. Hochsensible tendieren eher zu emotionaler als zu sozialer Einsamkeit. Sind die Beziehungen zu oberflächlich, kann es sein, dass sich HSP mit Menschen einsamer fühlen als ohne. Atemtechniken, kreative Aufgaben, und Selbstakzeptanz helfen ebenfalls. Außerdem können alle dafür wirken, dass das gesellschaftliche Bewusstsein für Hochsensibilität steigt, und versuchen, sich mit anderen HSP in ihrer Region zu verbinden. Kann sich Hochsensibilität auch positiv auf die psychische Gesundheit auswirken? Tom Falkenstein hilft seinen hochsensiblen Patienten immer, Situationen aus anderer Perspektive umzudeuten („Reframing“), und nutzt Psychoedukation, damit sich Hochsensible besser selbst verstehen und damit sie der Ressourcen bewusst werden, die sich aus ihrer Hochsensibilität ergeben. Elena Lupo sieht bei der psychischen Gesundheit einen sehr großen Unterschied zwischen Hochsensiblen, die Hilfe aufsuchen, und denen, die das nicht tun. Dabei sind Unterstützungen und Anleitungen im Umgang mit der Hochsensibilität und der Steigerung der Selbstwirksamkeit sehr hilfreich. Außerdem ist es für HSP wichtig, sich mit höheren Aufgaben oder Zielen zu verbinden – mit einem größeren Ganzen, ggf. auf einer spirituellen Ebene. Ebenfalls wichtig ist es für Hochsensible, aus dem Kopf heraus zu kommen. In der Regel denken sie zu viel. Denken und Fühlen müssen besser miteinander integriert werden. Körperbezogene Interventionen sind dabei hilfreich. Somatic Experiencing ist ein Beispiel dafür. Gibt es eine Verbindung zwischen Hochsensibilität und Introversion / Extraversion? Intro- und Extraversion scheinen bei HSP nicht anders als in der allgemeinen Bevölkerung verteilt zu sein. Betrachtet man die fünf Teile des „Big Five“-Persönlichkeitsmodells (zu denen auch Extraversion / Introversion gehört), korreliert Hochsensibilität eher mit den Bestandteilen Neurotizismus und Offenheit für Neues. Informationen zu neuen wissenschaftlichen Studien und über die kommenden Forschungsveranstaltungen findet sich im Netzwerk Sensitivity Research. Lesen Sie auch: • Gipfeltreffen der Hochsensibilitätsforschung 2024: ein Bericht • Coaching für hochsensible Menschen • Hochsensibilität am Arbeitsplatz und im Management • Schattenseiten der Hochsensibilität • Weitere Artikel und Blogs • Ablauf einer ersten Coachingsitzung • Kontakt und TerminvereinbarungAlexander Hohmann
Zertifizierter Life Coach
& Business Coach
Freiburg i. Br. & online
Deutsch - français - englisch